|
Inventar
Registriert seit: 08.02.2001
Beiträge: 9.977
|
 Gedanken zur Zensur von Worten und Themen
Gedanken zur Zensur von Worten und Themen
Nein, in diesem Thread geht es nicht darum, sich über mods zu beschweren, ich fand aber hinsichtlich der laufenden Diskussion @topic folgenden Artikel einer Feministin wirklich lesenswert und da es im Beisl dieses prob nicht gibt poste ich das hier exklusiv  :
Darf man "Fotze" sagen?
Zitat:
Kolumne In der feministischen und antirassistischen Debatte spielen Worte eine wichtige Rolle. Doch wann werden sie beleidigend? Und wie viel Zensur verträgt ein freier Diskurs?
In Hass sprich – zur Politik des Performativen setzt sich Judith Butler intensiv mit dem Verletzungspotential von Sprache auseinander. Sie dreht und wendet die Frage, wie Herrschaftsverhältnisse durch Sprechakte immer wieder hergestellt und somit verstetigt werden. Butler ist vielen vor allem als Vertreterin der Queer Theory bekannt – mit ihrem Werk Das Unbehagen der Geschlechter wendete sich die Philosophin gegen eine binäre Codierung der Geschlechter und damit gegen das Bollwerk der sogenannten „Modernen Wissenschaften“: Die Naturalisierung von (Macht-)Unterschieden qua Geschlecht. Bis heute werden WissenschaftlerInnen weltweit nicht müde, die „Beweise“ für die Differenzen zwischen Männern und Frauen zu liefern – zentraler Angelpunkt sind dabei meistens die Hormone. (In einer recht anschaulichen amerikanischen Studie fanden ForscherInnen derweil heraus, dass je nach Grad des Glaubens an Stereotype sich auch die tatsächliche Ausprägung und Wirkung von Sexualhormonen verändere ; an anderer Stelle besprach ich derweil schon die Differenzen der hierzulande breit rezipierten Vertreterinnen einer Hormon-gesteuerten Theorie der großen Unterschiede zwischen den Geschlechtern und wie sich die ganze Sache aus der Perspektive der Neurowissenschaften darstellt).
Abtreibung ist tabu
Dem setzt Butler wie viele andere eine Unterscheidung zwischen „Sex“ – also dem biologischen Geschlecht, und „Gender“ – also dem sozialen Geschlecht - entgegen. „Gender“ aber ist in vielen Kreisen ein unbenutzbares Wort. Zum Beispiel in der Universität – ja genau. Viele andere Studienfächer blicken verächtlich auf die „Gender Studies“ herab – so nannte neulich ein Jurist in meiner Hörweite dieses Fach „einfach nur Bullshit“. Die meisten Biologen, die ich von früher kenne, halten es für ein Studienfach, das man eigens für alle weltfremden SpinnerInnen und Anarchos erfunden haben muss. „Gender“ ist an vielen Orten im Internet ein Un-Wort. Genau wie „Feminismus“. Aber Un-Wörter variieren ja auch je nach kulturellem Deutungshorizont: Wussten Sie, dass in den USA das Wort „Abtreibung“ mittlerweile in TV-Sendungen durch einen Piepton ersetzt wird? Nein? Ich auch nicht, bis ich bei Judith Butler davon las. Es ist wohl in der Tat so, dass alleine das Wort die religiösen Gefühle vieler Menschen derart verletzt, dass man sich dazu entschloss, es nicht mehr auszusprechen. Und auch das Wort „Homo“, wie auch „schwul“ kann in bestimmten Kontexten ein Trigger, ein Schwert – ja: eben eine richtige Beleidigung sein.
Das Wort „Fotze“ ist wirklich ein beleidigendes Schimpfwort. Als ein Junge aus meiner Schule es zum ersten Mal zu mir sagte, setzte ich mich hinterher hin und schlug es im Fremdwörterbuch nach. Auch wenn das lustig klingen mag: Der Schlag in die Magengrube, dieses Wort aus dem Mund des Jungen an mich gerichtet zu hören, in den ich seit langem schwer verliebt war, ist bis heute präsent, wenn jemand es benutzt. Das erklärt meinen großen Widerwillen, wenn zum Beispiel junge Feministinnen, ganz nach der Manier der Selbstaneignung von Worten – wie dies auch beim dem Wort „Slut“ im Zuge der „Slutwalks“ geschah – „Fotze“ benutzen, um sich und andere junge Feminstinnen damit zu betiteln. „Lieblingsfotzen“ ist ein so entstandener Begriff – mit dem ich mich bis heute nicht anfreunden kann. Und auch nicht muss. Aber vielleicht – und genau das habe ich von Judith Butler gelernt – muss ich damit leben, dass es existiert; dass andere es benutzen; dass es mich immer wieder ein kleines bisschen an damals erinnern wird, wieder verletzen.
Wir werden die Machtverhältnisse in der Gesellschaft nicht ändern, wenn wir es uns und anderen verbieten, die Wörter, die sie symbolisieren, zu benutzen. Im Gegenteil: Wenn wir das Potential des Triggers – und damit das Potential zum Aufruhr, zum Protest oder zur kleinen Revolution – einfach wegradieren, wenn wir anfangen so zu reden, als sei es erstens überhaupt möglich und zweitens erstrebenswert, dass wir durch unsere Sprechen niemanden mehr verletzen können; niemanden mehr ein zweites Mal traumatisieren; alle Machtverhältnisse beseitigen – dann werden wir: Am Ende nicht mehr reden können. Geschweige denn handeln. Eine antiseptische Sprache führt zu Erstarren.
"Trigger-Potential" tut der Debatte gut
So sind denn Sprech-Verbote, zum Beispiel weil jemand das Wort „Neger“ in einer Überschrift benutzt, oder Rügen – es sei ein triggerndes und verletzendes Wort, das dürfe man nicht benutzen – gerade mit Butler gedacht kein kluger Umgang mit einem Konflikt. Denn dann landen wir allzu schnell bei der Sprachlosigkeit. Ich habe bei besagtem Zeit-Artikel den Versuch gemacht, das Wort „Neger“ durch „N.“ zu ersetzen, wie es die Kritikerin Nadine Lantzsch auch tut. Im zweiten Anlauf habe ich den Text so umgeschrieben, dass es gar nicht mehr darin vorkommt. Der Artikel verliert damit tatsächlich einen Großteil seiner bauchgruben-treffenden Wucht. Er verliert deutlich an „Trigger“-Potential. Und das tut der Debatte überhaupt nicht gut. Es wird immer etwas geben, das irgendjemanden triggert. Sei es „Fotze“, sei es „Abtreibung“ oder eben „Neger“. „Dass die Sprache ein Trauma in sich trägt, ist kein Grund, ihren Gebrauch zu untersagen. Es gibt keine Möglichkeit, Sprache von ihren traumatischen Ausläufern zu reinigen und keinen anderen Weg, das Trauma durchzuarbeiten, als die Anstrengung zu unternehmen, den Verlauf der Wiederholung zu steuern.“ (Judith Butler: Hass spricht; Frankfurt 2006: S. 66)
|
|

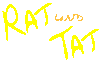

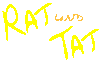

 :
: